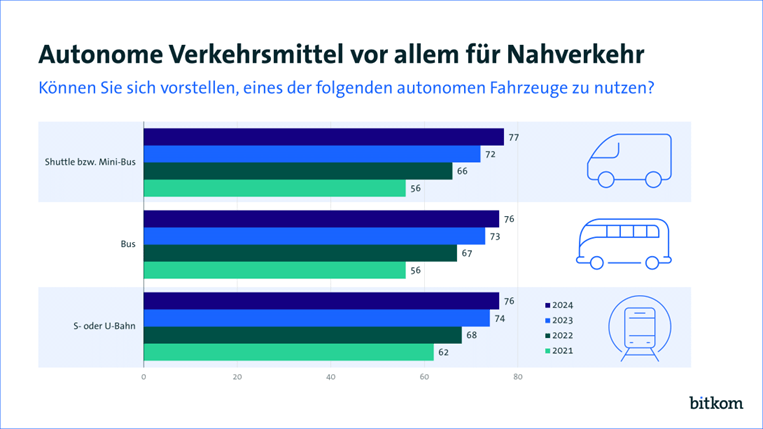Die Verlängerung der Frankfurter Straßenbahn nach Neu-Isenburg, Dreieich und Langen hat großes Potenzial – wirtschaftlich, technisch und städtebaulich. Das ist das Ergebnis der vertiefenden Machbarkeitsstudie, die jetzt vorgestellt wurde. Das beauftragte Beratungsunternehmen Ramboll empfiehlt sehr eindeutig, die weiteren Planungen für die Straßenbahn voranzutreiben.
Die Bürgermeister der drei Städte, Martin Burlon (Dreieich), Dirk Gene Hagelstein (Neu-Isenburg), Prof. Dr. Jan Werner (Langen) und der Frankfurter Mobilitätsdezernent Wolfgang Siefert begrüßen die Ergebnisse der Untersuchung. Für die wirtschaftliche Betrachtung, so erklärt Hartwig Meier, Chefplaner der Frankfurter Nahverkehrsgesellschaft traffiQ, ist der Kosten-Nutzen-Faktor entscheidend: Liegt der errechnete Wert über 1,0, ist der Bau der Strecke volkswirtschaftlich sinnvoll. Das ist zugleich Voraussetzung für die finanzielle Förderung durch Bund und Land, die sich auf über 90 Prozent der Kosten belaufen kann. Für die Verlängerung der Straßenbahn bis nach Langen Bahnhof ermittelten die Gutachter einen herausragenden Wert von 2,20. Wenn die Straßenbahn nur bis zum Weibelfeld in Dreieich geführt würde, läge der Kosten-Nutzen-Wert immer noch bei 1,74.
Auch technisch machbar ist die Straßenbahnverlängerung nach Einschätzung der Gutachter. Zudem bietet sie großes Potenzial, die Innenstädte von Neu-Isenburg, Dreieich und Langen stadtgestalterisch aufzuwerten. Die Aufenthaltsqualität lässt sich deutlich erhöhen, der Verkehrsraum kann ansprechend gestaltet und zeitgemäßer aufgeteilt werden – durch eine höhere Aufenthaltsqualität etwa durch Außengastronomie, mehr Raum für Rad- und Fußverkehr oder Logistikdienste, Barrierefreiheit und Begrünung, durch Reduzierung des Durchgangsverkehrs. Nicht zuletzt bietet sich die Chance, die Städte klimaresilienter umzubauen.
Für die vier Partner spielt die nachhaltige Bewältigung des Verkehrs im Ballungsraum Rhein-Main bei ihren Überlegungen eine wichtige Rolle: „Eine Straßenbahnverbindung von Frankfurt über Neu-Isenburg bis nach Dreieich und Langen könnte ein zukunftsweisendes Angebot für die vielen Pendlerinnen und Pendler sein, die heute täglich im Westkreis Offenbach unterwegs sind oder von dort nach Frankfurt fahren. Den beteiligten Städten bietet sie zudem starke stadtgestalterische Möglichkeiten und Frankfurt wird vom Pendlerverkehr entlastet“, erklären die Bürgermeister und der Mobilitätsdezernent gemeinsam. Sie werden sich in ihren Kommunen für eine zügige Fortsetzung der Planungen einsetzen. Denn das gesamte Verfahren ist sehr umfangreich, als nächster Schritt ist in die Vorplanung einzusteigen. Neben der Verkehrsanlagenplanung werden auch Betriebs-, Förder- und Finanzierungskonzepte benötigt, bevor später mit der Genehmigungsplanung und Bauphase begonnen werden kann. Ab etwa 2034 könnte die erste Straßenbahn über die Frankfurter Haltestelle „Neu-Isenburg Straßenbahn“ in Richtung Langen ihre Fahrt aufnehmen.
Die Kosten für die Studie in Höhe von 470.000 Euro wurden zu gleichen Teilen von den Städten Dreieich, Langen und Neu-Isenburg sowie der Frankfurter Nahverkehrsgesellschaft traffiQ getragen.
Quelle: traffiQ