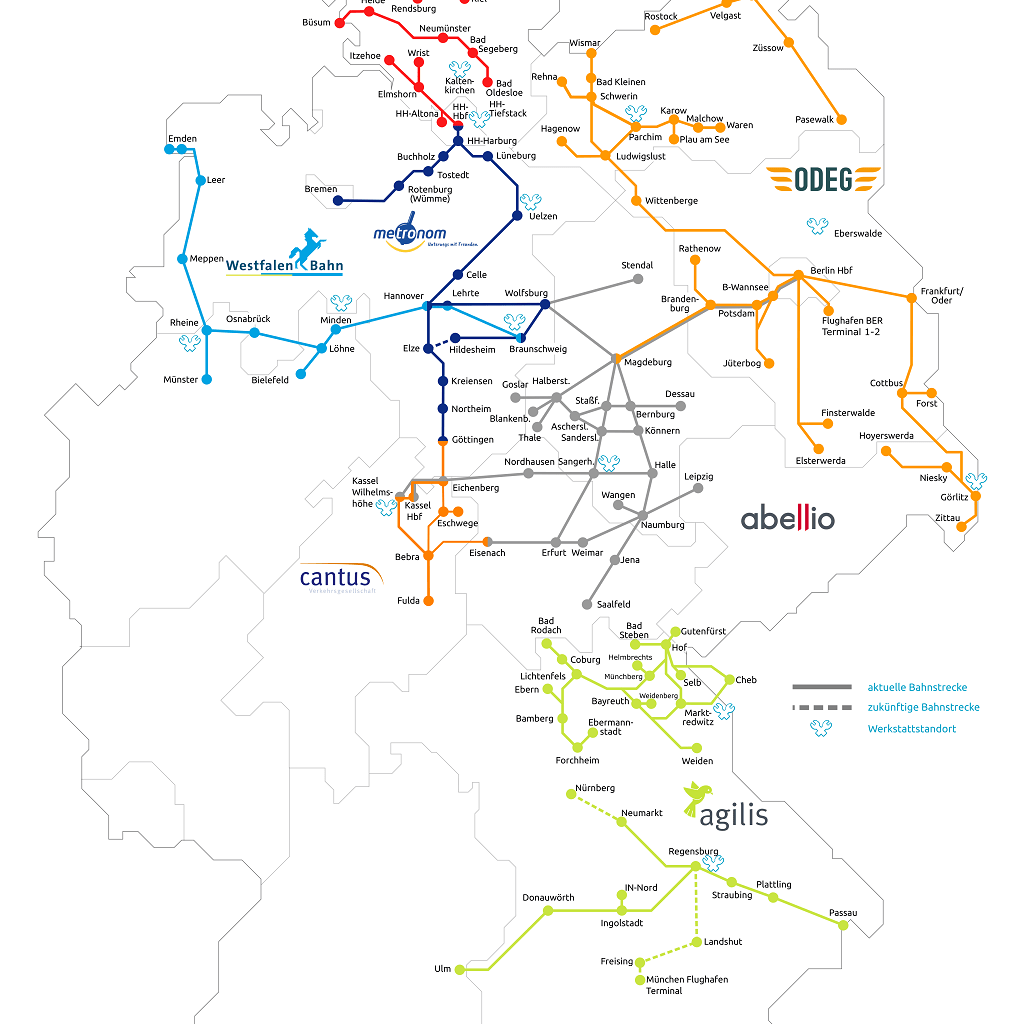Die Elektrotransformation der Transportbranche nimmt Fahrt auf und steuert auf einen Kipppunkt vor 2030 zu. Das prognostiziert die Studie „Battery-electric trucks on the rise” von Strategy&, der globalen Strategieberatung von PwC. Weltweit jeder fünfte Bus und Lkw werden demnach im Jahr 2030 batterieelektrisch angetrieben werden. Zehn Jahre später sind voraussichtlich bereits 90 Prozent des Transports elektrifiziert. Während das Produktionsvolumen der drei größten Märkte Nordamerika, Europa und Großchina im Jahr 2030 bei etwa 600.000 E-Lkw (Battery Electric Truck, BET) liegen wird, schießt es im Jahr 2040 auf mehr als 2,7 Millionen BETs in die Höhe. Diese Beschleunigung wirkt sich auch auf den globalen Batteriemarkt aus. Im Jahr 2030 werden bereits 13 Prozent der gesamten Batteriekapazität von Fahrzeugen in BETs verbaut (ca. 450 GWh), 2035 liegt der Anteil bereits doppelt so hoch. Angetrieben wird die Elektrotransformation des Transportsektors vor allem von technologischen Fortschritten, sinkenden Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership, TCO) sowie strikterer Regulatorik.
Die regulatorischen Vorschriften ziehen dabei in Europa besonders stark an. Bis 2030 müssen europäische OEMs ihre Truck-Emissionen um etwa 45 Prozent im Vergleich zum Referenzjahr reduzieren, bis 2040 sogar um 90 Prozent. Zugleich greifen in Europa bis 2030 punktuelle, urbane Fahrverbote für konventionelle Lkw. Der aktuelle Entwurf sieht für die Hersteller in den USA bis 2040 eine Emissionsreduktion um 40 Prozent vor, in China liegt die geplante Zielmarke für 2040 bei Minus 35 Prozent. In allen drei Märkten verschärft sich die Regulatorik ab 2030 merklich, um einen stärkeren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Zwar sind im Straßenverkehr insgesamt weniger Lkw als Pkw unterwegs, dafür spart ein elektrifizierter Lkw im Schnitt mehr als 20-mal so viel CO2 wie ein elektrisch angetriebener Pkw ein.
Neue E-Lkw-Generation bereit für den Fernverkehr
In den kommenden Jahren erweitern technologische Innovationen zugleich die Einsatzmöglichkeiten von BETs. Bis 2030 prognostiziert die Studie einen Reichweitensprung um circa 50 Prozent von 600 auf 900 Kilometer, die durchschnittliche Ladegeschwindigkeit erhöht sich um 200 Prozent auf bis zu 1.200 kW, die Kosten für BET-Antriebsstränge gehen um etwa 10 Prozent zurück. Das Ergebnis: BETs können wirtschaftlich sinnvoll im Fernverkehr und auf Linienverbindungen zwischen Logistik-Hubs eingesetzt werden.
„Nachdem der Transportsektor lange mit der Umstellung auf Elektro-Lkw gehadert hat, beobachten wir nun einen tiefgreifenden Wandel in der Branche. Die dritte E-Lkw-Generation bringt neue Plattformen für unterschiedliche Kundenanforderungen und den breiten Einsatz in verschiedensten Anwendungsszenarien mit sich“, sagt Dr. Jörn Neuhausen, Senior Director und Leiter Elektromobilität bei Strategy& Deutschland. „Grundvoraussetzung dafür ist allerdings, dass private und öffentliche Akteure von Regulatorik über die Automobil- und Energiebranche hin zur Logistik und der Finanzindustrie kooperieren. Das Jahr 2030 markiert in dieser Entwicklung einen Meilenstein, ab dem sich die Transformation der Branche regulatorisch bedingt deutlich beschleunigen wird.“
Depot-Ladepunkte Schlüssel für Transformation
Für den Elektrodurchbruch ist die Ladeinfrastruktur vor allem deswegen entscheidend, weil Energiekosten in der Logistik traditionell einen Löwenanteil der Gesamtbetriebskosten ausmachen. Da Strom im Normalfall günstiger ist als Diesel, fahren E-Lkw ihren TCO-Vorsprung vor allem durch die geringeren Energiekosten ein. Dieser Vorteil schlägt sich allerdings nur dann nieder, wenn es ausreichend schnelle und günstige Ladepunkte gibt. Dafür sind laut Studie erhebliche Investitionen notwendig – sowohl von öffentlicher Hand, vor allem aber von der Logistikbranche selbst. Bis 2035 liegt der öffentliche Investitionsbedarf in Europa demnach bei 6,1 Mrd. Euro, um 720 Ladeparks zu errichten und damit eine flächendeckende Ladeinfrastruktur zu gewährleisten. Hinzu kommen 28,6 Mrd. Euro, die der private Sektor für etwa 28.500 Depot-Ladepunkte aufbringen müsste.
„Beim Thema Laden lag der Fokus bislang stark auf öffentlichen Schnellladeparks, die zwar für die breite Abdeckung der Fläche notwendig sind, allerdings in der Auslastung großer Volatilität unterliegen können. Die Logistikbranche sollte daher in Zukunft zusätzlich selbst die Initiative ergreifen und verstärkt in Depot-Ladepunkte investieren. Dies ermöglicht eine deutlich verbesserte Planungssicherheit bezüglich der Infrastruktur-Auslastung und hilft somit, die Ladekosten im Griff zu behalten“, sagt Dr. Philipp Rose, Director bei Strategy& Deutschland und Leiter Elektromobilität bei PwC Deutschland. „Neben der Optimierung der Ladekosten für Nutzer geht es bei der Umstellung auf E-Lkw natürlich auch um den Einsatz einer geeigneten Batterie-Technologie seitens der Hersteller. Die Auswahl der passenden Zellchemie ist entscheidend für den entsprechenden Einsatzzweck – so ist die Natrium-Ionen Technologie zukünftig eher für den Einsatz in der Distribution mit kleinen Lkw zweckmäßig. LFP, LMFP und NMC decken dagegen Langstreckenszenarien ab und sind je nach Region und Reichweite in vielen Use Cases rentabel einsetzbar.“
Weitere Infos zur Studie finden Sie hier
Quelle: PwC