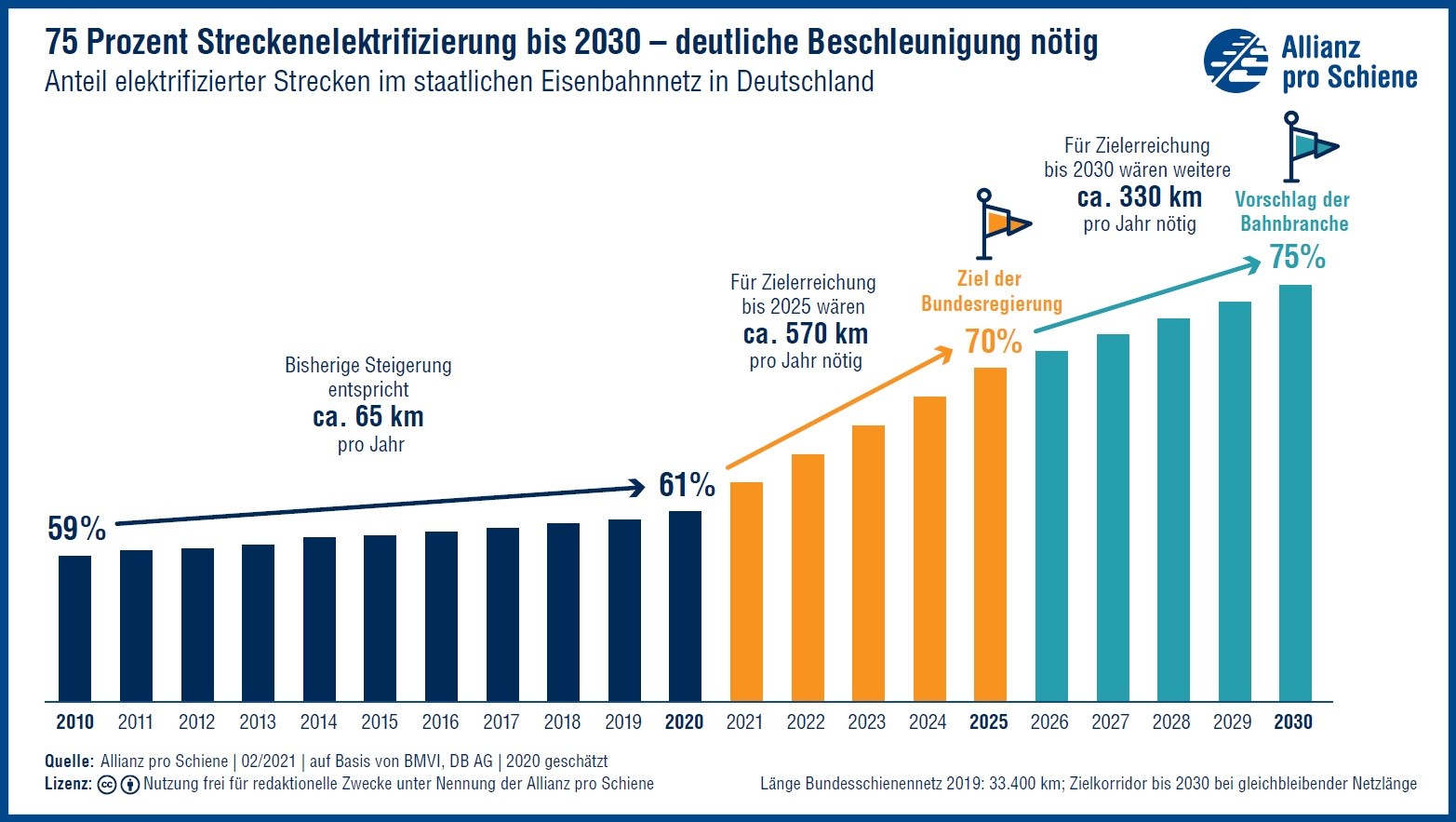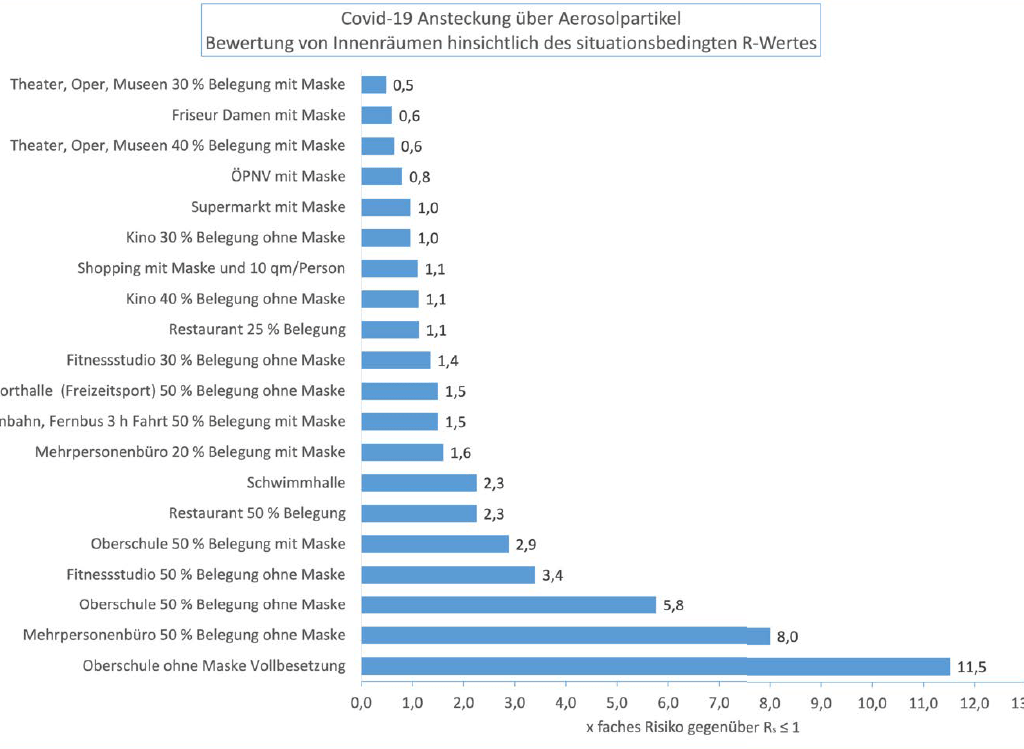Der Deutsche Mobilitätspreis geht in die neue Runde. Unter dem Motto „intelligent unterwegs: Daten machen mobil.“ suchen die Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ und das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) ab sofort innovative Leuchtturmprojekte und kreative Ideen, die das Potenzial von Daten, Datentausch und Datenveredelung für die Mobilität von morgen nutzen.
Dabei stehen Güter- und Personenverkehr gleichermaßen im Fokus. Wie können geteilte Daten helfen, bedarfsgerechtere Mobilitätsangebote zu schaffen? Wie können wir Daten aus verschiedenen Quellen bündeln, um Lieferketten zu optimieren und die Kapazitäten noch effizienter zu nutzen? Wie können bessere Wettervorhersagen mit KI-Anwendungen zu passgenaueren Verkehrsangeboten beitragen? Welche Änderungen der Verkehrsströme werden aufgrund von Homeoffice dauerhaft bleiben und wie können wir diesen gerecht werden? Bis zum 29. März 2021 können sich Zukunftsmacher bewerben.
Gesucht werden sowohl Ideen von Profis als auch Ideen von weniger erfahrenen Zukunftmachern. Auf die Idee kommt es an! Für bereits erfolgreich umgesetzte Leuchtturmprojekte und erstellte Prototypen gibt es den Best-Practice-Wettbewerb. Teilnehmen können hierbei Unternehmen, Start-ups, Städte und Gemeinden, Universitäten oder Forschungsinstitutionen, die ihren Sitz in Deutschland haben.
Der Ideenwettbewerb wendet sich direkt an alle Bürger. Gesucht werden kreative Impulse und Visionen zum Wettbewerbsthema. Alle Ideen und Konzepte können eingereicht werden, die zeigen, wie durch den intelligenten Einsatz von Daten Mobilität noch effizienter, ökologischer oder bedarfsgerechter gestaltet werden kann. Die besten drei Ideen werden mit einem Gesamtpreis von insgesamt 6.000 Euro honoriert.
Eine Expertenjury wählt die zehn innovativsten Best-Practice-Leuchtturmprojekte und die drei kreativsten Ideen aus der Bevölkerung aus. Außerdem wird in diesem Jahr zum zweiten Mal ein Sonderpreis in der Kategorie „bürgerschaftliches Engagement im Mobilitätsbereich“ vergeben.
Mit dem Deutschen Mobilitätspreis machen die Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ und das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur intelligente Mobilitätslösungen und digitale Innovationen öffentlich sichtbar. Folgende Partner unterstützen den Wettbewerb: Deutsche Bahn, VDV, Siemens Mobility.
Quelle: BMVI