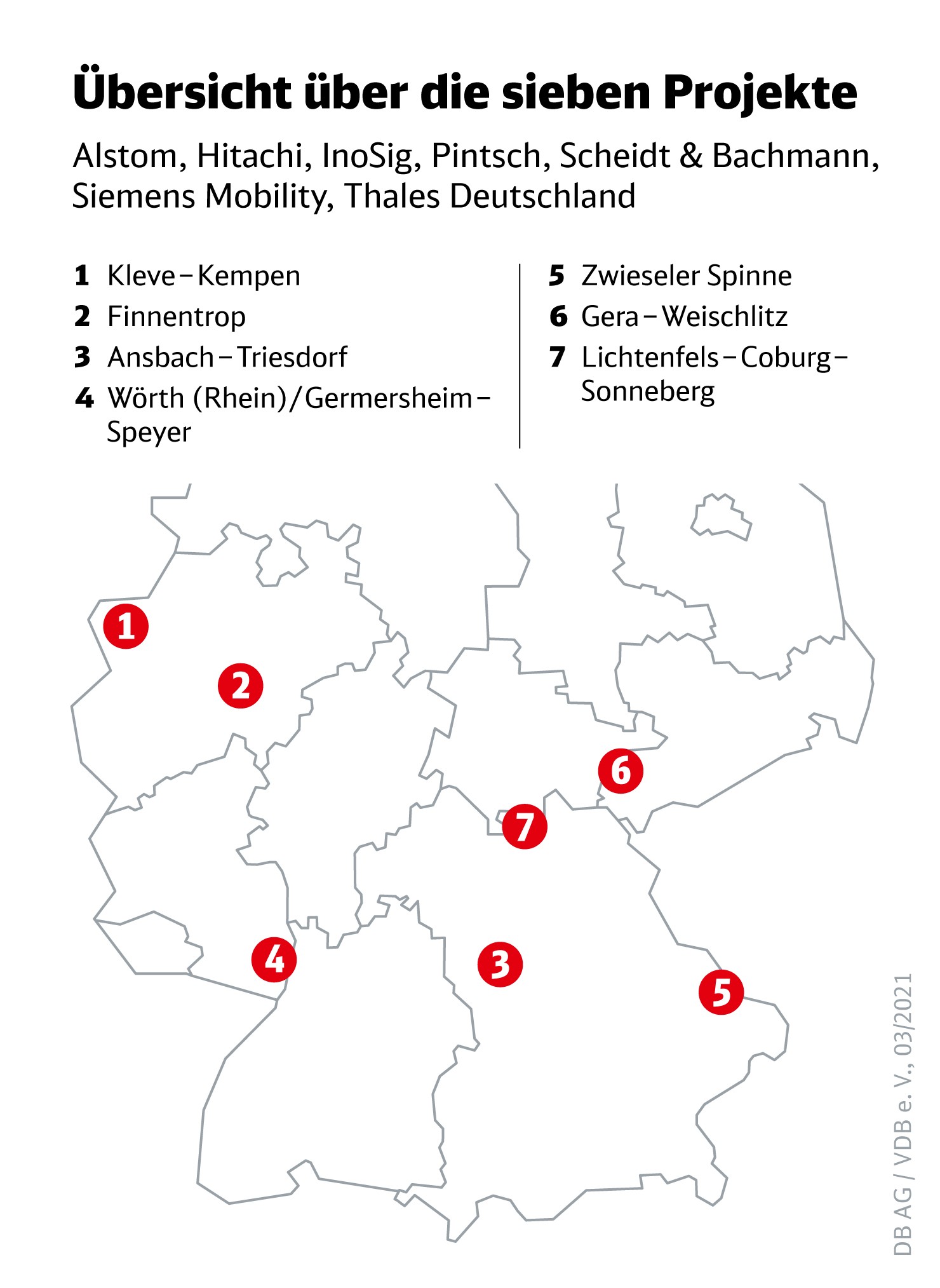70 Jahre Setra. Mit insgesamt sechs Baureihen hat die Ulmer Traditionsmarke in den vergangenen sieben Jahrzehnten oftmals Maßstäbe im europäischen Omnibusbau gesetzt und ihn entscheidend mitgeprägt.
Die Geburtsstunde schlug im Jahr 1951, als die Ulmer Kässbohrer Fahrzeugwerke den S 8 vorstellten und der Marke ihren Namen gaben, der schlicht für selbsttragend steht. Der erste in Serie gefertigte Omnibus mit selbsttragender Karosserie, Heckmotor und direktem Antrieb auf die Hinterachse wurde anlässlich der „Internationalen Automobil Ausstellung“ IAA in Frankfurt präsentiert.
Die ersten Setra Omnibusse verhalfen dem Prinzip der selbsttragenden Bauweise zu ihrem Durchbruch. Der Verkaufsschlager war der S 10, der zweite Setra-Typ nach dem S 8.
Völlig neu für diese Zeit des Omnibusbaus war das erste Setra Baukastensystem, das im Jahre 1959 eingeführt wurde. Dank dieses konsequent durchdachten Modul-Prinzips konnten die Fahrzeuge rationell hergestellt werden. Die Tagesproduktion lag in dieser Zeit bei vier Einheiten.
Der Übergang der Setra Baureihe 10 zur Baureihe 100 im Jahr 1967 war ein weiterer Schritt zur Industrialisierung des Omnibusbaus im Unternehmen. Alle neuen Modelle wurden nach dem zweiten Setra Baukasten aus zahlreichen Gleichteilen gefertigt.
Im Jahr 1976 ging die Setra Baureihe 200 mit sechs Typen an den Start. Die Fahrzeuge der dritten Setra Generation bestachen durch eine zeitlose Eleganz in der Linienführung ihres Designs, das auf Wertbeständigkeit und Zweckmäßigkeit ausgerichtet war. Weiche Rundungen und sanfte Übergänge sowie klare Konturen entsprachen ganz den damals aufkommenden elementaren Grundsätzen des Fahrzeugdesigns.
Das Jahr 1991 war das Startjahr für die Baureihe 300, die nach einer sechsjährigen Entwicklungszeit in Ulm präsentiert wurde. Zu den auffälligsten Merkmalen der neuen Busse gehörten die markante Schwinge hinter dem Cockpitbereich sowie das völlig neuentwickelte Integralspiegelsystem, das der Baureihe ihr einzigartiges „Gesicht“ verlieh.
Während sich die Reisebusse der Baureihe 300 auf dem europäischen Omnibusmarkt etablierten, arbeiteten die Entwickler an der Markteinführung der Kombibusse für den Linien-, Überlandlinien- und Ausflugsverkehr. Aus einem Basismodell wurden in modularer Bauweise drei verschiedene Busvarianten entwickelt. Sie alle hatten den gleichen Aufbau, das gleiche Fahrwerk, jedoch unterschiedliche Fahrgasträume.
Um die Übersicht über die Modellpalette zu erleichtern, begann mit der Baureihe 300 die Gliederung des Omnibus-Angebots in die drei Gattungen TopClass, ComfortClass und MultiClass.
Das aktuelle Flaggschiff der Traditionsmarke ist der Doppelstockbus S 531 DT. Die Markteinführung erfolgte 2019.
Quelle: Daimler